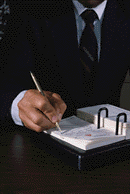Warum der Verein für Existenzsicherung e. V. besser und schneller als Schuldnerberatungsstelle ist

Die überschuldeten Verbraucher haben die Möglichkeit sich bei den karitativen Schuldnerberatungsstellen zu melden. Diese behaupten, kostenlos zu arbeiten. Diese Aussage ist nicht richtig, denn die Steuerzahler finanzieren diese Beratung. Dadurch sind diese Beratungsstellen natürlich auch überlaufen, da bereits 2017 bei jeder zehnten Beratung die Wartezeit mehr als 20 Wochen betragen hat. Da in Überschuldungsfällen häufig Zahlungsfristen und Mahnverfahren mit zusätzlichen Gebühren im Raum stehen, ist eine möglichst zeitnah beginnende Schuldnerberatung für die Betroffenen von großer Bedeutung. Im schlimmsten Fall können existenzielle Folgen eintreten, wie beispielsweise Stromsperren oder eine Kündigung des Mietvertrages. So hat beispielsweise 2016 nachdem die Bearbeitung nach der Wartezeit begonnen hat, im Durchschnitt 16 Monate gedauert. 2016 dauerte Bearbeitungszeit durch die karikative Schuldnerberatungsstelle in 18 % der Fälle länger als zwei Jahre. In einem uns vorliegenden Fall ist der Mandant seit zwei Jahren bei einer karitativen Stelle in Bearbeitung und es wurden bis heute noch nicht mal die Gläubiger angeschrieben. Deshalb hat er sich einen Verein für Existenzsicherung e. V. gewandt, damit wir hier kurzfristig helfen und den Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht stellen konnten. Leider ist dies kein Einzelfall. Ebenso gehen manche der karitativen Stellen dazu über, die Gläubiger nicht selbst anzuschreiben, sondern den Schuldnern einen Musterbrief in die Hand zu drücken und die Arbeit selbst machen zu lassen. Dieses Verhalten ist unakzeptabel. Es bewahrheitet sich der alte Spruch.“ Alles was nichts kostet taugt, taugt nichts.“
Dies ist natürlich für Verbraucher, bei denen der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht nicht hinnehmbar. Hier ist es wichtig eine professionelle Schuldnerberatung aufzusuchen, die sehr kurze Wartezeiten hat und den Fall schnell bearbeiten kann. Diese professionelle Schuldnerberatung, wie der Verein für Existenzsicherung e. V. kostet natürlich eine Gebühr, da er nicht vom Staat finanziert wird. Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass eine seriöse Schuldenberatungsstelle eine Zulassung nach Paragraf 305 InsO hat. Dazu ist zu bemerken, dass der Beruf des Schuldenberaters bis heute nicht geschützt ist und es bis heute keine Ausbildung für den Beruf des Schuldenberaters gibt. Jeder Versicherungsvertreter, der eine Hausratversicherung vermittelt, muss eine IHK Ausbildung absolvieren. Wir fordern bereits seit 1999, dass eine Ausbildung bei IHK angesiedelt wird. Warum dies nicht geschehen ist, ist nicht nachvollziehbar. Aus diesem Grund ist auch nicht nachvollziehbar weshalb die karitativen Stellen automatisch eine Zulassung auf 305 InsO bekommen haben, da diese ja auch keine Ausbildung nachweisen können. Hier ist das Verbraucherschutzministerium gefordert eine Ausbildung bundesweit einzuführen.
Da es mittlerweile auch sehr viele seriöse Schuldnerberatungsstellen gibt, die nicht vom Staat finanziert werden, sondern Gebühren verlangen müssen, fordern wir, dass die staatlich subventionierte Schuldnerberatung eingestellt wird und alle Schuldnerberatungsstellen, auch die karitativen Gebühren für die Bearbeitungen von den Schuldner verlangen müssen. Jeder der Schulden gemacht hat, hat dies auf eigene Veranlassung gemacht. Deshalb ist nicht nachvollziehbar weshalb der Steuerzahler für die Kosten aufkommen soll. Wir sind der Auffassung, dass jeder der Schulden gemacht hat und durch das Insolvenzverfahren aus den Schulden herauskommen will, auch die Kosten dafür zu tragen hat. Wir fordern auch, dass diese Kosten für alle Schuldnerberatungsstellen einheitlich gesetzlich geregelt werden müssen.
Dadurch gibt es keinerlei Wartezeiten bei den karitativen Stellen und auch die anderen seriösen Schuldnerberatungsstellen sind gleichmäßig ausgelastet. Die Wartezeiten für die Schuldner werden reduziert und der Steuerzahler wird finanziell dadurch entlastet.
Da es hier keine Ausbildung gibt, fordern wir die Staatsregierung auf, dass jeder der eine fundierte kaufmännische Ausbildung nachweisen kann, die Zulassung nach 305 InsO erhält. Die Hauptaufgaben von geeigneten Stellen und Personen nach Paragraf 305 InsO bestehen darin, den Schuldner persönlich zu beraten, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse fachgerecht zu prüfen und den Schuldnern bei der Schuldenbereinigung zu helfen. Dies schließt insbesondere mit ein, dass die Schuldnerberatung die Interessen des Schuldners bei einer ausführlichen Einigung mit den Gläubigern mit Blick auf einen Schuldenbereinigung Plan vertritt. Misslingt der außergerichtliche Einigungsversuche mit den Gläubigern, stellt die Schuldnerberatung eine Bescheinigung hierüber aus und klärt den Schuldner über die Voraussetzungen zur Öffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens auf. Diese Tätigkeit kann jeder der eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung hat durchführen. Wenn schon der Ökotrophologe (Ernährungsberater) lt. InsO dazu geeignet ist, sollte auch ein Sozialversicherungsfachangestellter dazu geeignet sein.